Führen zwischen den Generationen – Chancen mit Soziodrama sichtbar machen

„Als Babyboomerin mit über vier Jahrzehnten Berufserfahrung…
… habe ich viele Wellen der Arbeitswelt miterlebt: von der klassischen Hierarchie über Lean Management bis hin zu Agilität und New Work. Jede Phase brachte neue Begriffe, neue Erwartungen und neue Hoffnungen. Doch eines ist geblieben: Arbeit ist immer Begegnung zwischen Menschen – und diese Begegnungen sind von Generation zu Generation unterschiedlich geprägt.
Heute arbeiten in vielen Unternehmen vier Generationen Seite an Seite: die Babyboomer, die Generation X, die Generation Y (Millennials) und die Generation Z. Sie bringen unterschiedliche Werte, Kommunikationsstile und Vorstellungen von „guter Arbeit“ mit. Das sorgt nicht selten für Missverständnisse und Spannungen. Gleichzeitig liegt darin ein enormes Potenzial – wenn es Führungskräften gelingt, Brücken zu bauen und Chancen sichtbar zu machen.
Genau darum soll es in diesem Beitrag gehen: Welche Unterschiede gibt es wirklich, warum entstehen Reibungen und wie lassen sich diese produktiv nutzen? Am Beispiel einer Team-Intervention mit Einsatz der Methode Soziodrama wird deutlich, wie Generationen-Potenzial vom Team konkret genutzt werden kann.
1. Unterschiede zwischen den Generationen
Wenn man die gängigen Beschreibungen der Generationen nebeneinanderlegt, zeigen sich schnell einige typische Unterschiede:
• Babyboomer (geboren 1946–1964): geprägt von Aufbaujahren und Wirtschaftswachstum. Arbeit steht oft im Zentrum der Identität, Loyalität gegenüber Arbeitgebern ist hoch. „Leistung lohnt sich“ – dieses Motto hat viele geprägt.
• Generation X (1965–1979): erlebte Krisen, Arbeitslosigkeit und den Beginn der Globalisierung. Werte wie Unabhängigkeit, Pragmatismus und eine gesunde Skepsis gegenüber Institutionen sind verbreitet.
• Generation Y / Millennials (1980–1995): suchen nach Sinn, Flexibilität und Selbstverwirklichung. Work-Life-Balance und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben haben hohe Priorität.
• Generation Z (ab 1996): wächst in einer digitalen Welt auf, für sie sind Geschwindigkeit, Vernetzung und Vielfalt selbstverständlich. Sie stellen stärker die Frage: „Was bekomme ich zurück, wenn ich mich engagiere?“

Diese Unterschiede zeigen sich im Arbeitsalltag ganz konkret
Die unterschiedlichen Prägungen der Generationen werden im Miteinander oft subtil sichtbar, manchmal aber auch sehr deutlich. Einige typische Beispiele:
• Meetings und Entscheidungsfindung: Babyboomer und viele Vertreter der Generation X sind es gewohnt, Entscheidungen nach gründlicher Analyse und Hierarchie zu treffen. Jüngere Generationen, besonders die Generation Y und Z, wünschen sich schnelle, iterative Entscheidungen – lieber ausprobieren, Feedback holen und nachjustieren.
• Kommunikationsstile: Babyboomer bevorzugen häufig persönliche Gespräche, Telefonate oder formellere E-Mails. Millennials und Gen Z setzen auf kurze, direkte digitale Kommunikation (Chat, Messenger, Emojis).
• Feedback-Kultur: Für viele Ältere war Feedback etwas Besonderes, das einmal im Jahr im Mitarbeitergespräch gegeben wurde. Jüngere erwarten kontinuierliche Rückmeldungen und interpretieren das Ausbleiben von Feedback manchmal als mangelndes Interesse.
• Arbeitszeiten und Präsenz: Babyboomer sind mit dem Selbstverständnis aufgewachsen: „Man zeigt Einsatz durch Anwesenheit.“ Generation Y und Z legen Wert auf Flexibilität, Homeoffice und Work-Life-Balance.
• Karriereverständnis: Für Babyboomer und viele aus Generation X war die klassische „Karriereleiter“ ein zentrales Ziel. Millennials und Gen Z suchen eher „Karrierewege im Mosaik“.
2. Chancen erkennen statt an Konflikten aufreiben
Unterschiede müssen nicht zwangsläufig zu Konflikten führen. Sie können vielmehr ein Schatz sein – wenn Führungskräfte und Teams lernen, diese Vielfalt konstruktiv zu nutzen.
• Erfahrung trifft auf Innovation: Babyboomer bringen oft tiefes Fachwissen und Gelassenheit in Krisen mit, während Jüngere frische Perspektiven und digitale Kompetenzen einbringen.
• Loyalität trifft auf Flexibilität: Generation X und Babyboomer schätzen Stabilität, Generation Y und Z fördern hingegen Beweglichkeit – eine Mischung, die Organisationen robuster macht.
• Diplomatie trifft auf Naivität: Ältere Mitarbeitende verfügen durch ihre lange Unternehmenszugehörigkeit über wertvolles diplomatisches Potenzial. Sie wissen, wie politische Prozesse laufen, wie Entscheidungen „über Bande“ zustande kommen und wen man wie ansprechen muss. Jüngere dagegen wollen häufig „einfach mal ausprobieren“ – erfrischend, aber in komplexen Organisationen manchmal naiv.
• Sinn trifft auf Verantwortung: Jüngere suchen nach Purpose, Ältere können Sinn stiften, indem sie langfristige Entwicklungen und Werte einbringen.
Führungskräfte können hier Brückenbauer sein. Drei Haltungen haben sich in meiner Beratungspraxis besonders bewährt:
1. Zuhören und Fragen stellen: Neugier statt Vorurteil – welche Perspektive steckt hinter einer Haltung?
2. Rollen klären: Unterschiedliche Erwartungen sichtbar machen, z. B. mit Methoden aus dem Soziodrama.
3. Facilitation nutzen: Anstatt Lösungen vorzugeben, Räume schaffen, in denen alle Generationen gehört werden und gemeinsam Lösungen entwickeln.

3. Praxisbeispiel Soziodrama: Generationen-Chancen sichtbar machen
Anlass der Intervention war ein Team aus rund 15 Mitarbeitenden verschiedener Altersgruppen. Immer wieder kam es zu Blockaden: Jüngere beklagten eine „verkrustete“ Meetingkultur, Ältere empfanden das Verhalten der jüngeren Kolleg*innen als respektlos und ungeduldig. Die Konflikte lähmten die Zusammenarbeit – die eigentliche Arbeit blieb liegen.
Das Soziodrama ist eine Weiterentwicklung des Psychodramas von J. L. Moreno. Während Psychodrama den einzelnen Menschen und seine Rolle in den Mittelpunkt stellt, richtet sich Soziodrama auf Gruppen, Gemeinschaften und Organisationen. Es eignet sich besonders, wenn es um kollektive Dynamiken, Rollenbilder und Beziehungsmuster geht – genau das, was in generationenübergreifenden Teams häufig sichtbar wird.
Ablauf der Intervention
- Einstieg: Sammlung von Schlagworten, die die Teammitglieder mit den Generationen verbinden und Sammlung von Szenen, in den diese Schlagworte zum Einsatz kommen.
2. Aufstellung der Generationen: Teilnehmende bleiben zunächst in ihren eigenen Rollen, erst beim zweiten Durchgang wählen sie stellvertretend die Rolle einer anderen Generation.
3. Szenisches Arbeiten: Ausgewählte Szenen werden als kurze Vignetten mehrfach nachgespielt, u.a. wie Jüngere sofort ausprobieren wollen, während Ältere überlegen, welche internen Netzwerke vorher eingebunden werden müssen.
4. Reflexion und Transfer: Das Team erkennt, dass Unterschiede generationstypische Muster sind und gegenseitiges Verständnis förderlich ist.
5. Training neuer Muster: Durchspielen neuer Kombination von iterativen Ideen und diplomatischem Vorgehen, um Ergebnisse wirksam umzusetzen.
Wirkung: Das Soziodrama ermöglichte es, Rollenbilder sichtbar, erlebbar und verhandelbar zu machen. Statt sich an gegenseitigen Zuschreibungen aufzureiben, erkannte das Team das Potenzial, das in der Vielfalt steckt. Gerade die Kombination von diplomatischem Geschick und frischer Experimentierlust erwies sich als Schlüssel für mehr Effektivität. Durch eine ausführliche Anwärmung im Vorfeld des Szenischen Arbeitens entstand im Team eine Art Spiellust die das szenischen Arbeiten leicht machte. Das Team hatte seinen Spaß dabei.
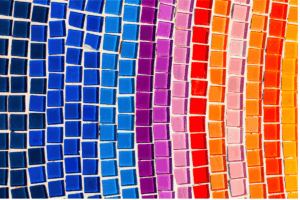
Fazit
Generationenvielfalt im Arbeitsleben bedeutet Spannungen – und zugleich Chancen. Jede Generation bringt eigene Stärken mit: Erfahrung, Diplomatie, Fachwissen, aber auch Innovationskraft, Sinnsuche und digitale Kompetenz. Wenn Teams diese Gegensätze nicht als Hindernis, sondern als Ergänzung begreifen, können sie einander beflügeln.
Soziodramatische Interventionen bieten die Möglichkeit, genau das erfahrbar zu machen: Unterschiedliche Rollen sichtbar zu machen, gegenseitiges Verständnis zu fördern und neue Verhaltensmuster auszuprobieren. Und das mit Leichtigkeit und einer ordentlichen Portion Spaß. So entstehen Teams, die Vielfalt nicht nur ertragen, sondern aktiv nutzen – für bessere Zusammenarbeit, tragfähige Entscheidungen und nachhaltige Veränderung.
Autorin: Nikola Paul, Senior Beraterin













