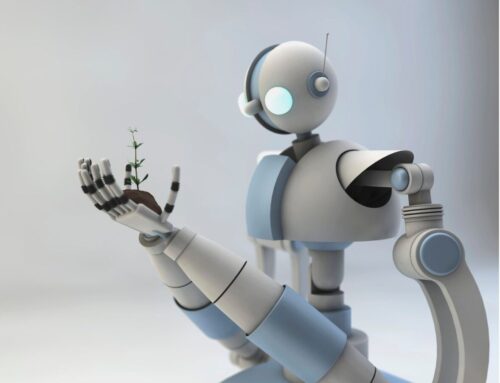Wenn „Ja“ kein Ausdruck für Zustimmung ist: Führung in Vielfalt


Melanie von Groll
Wenn „Ja“ kein Ausdruck für Zustimmung ist: Führung in Vielfalt
Kernthese: Vielfalt stärkt Organisationen – und fordert Führung. In diversen Organisationen entscheidet nicht das härteste Argument, sondern die beste Übersetzung zwischen Welten: zwischen Kultur und Aufgabe, zwischen Anspruch und Erfahrung, zwischen Stimme und Stille. Führung, die übersetzt, macht Potenziale sichtbar – gerade dort, wo Lebensläufe nicht linear sind.
Der Mythos der Eindeutigkeit: das Wort ,,Ja“
Szene 1: Das Entwicklungsgespräch
Neue Kollegin, neues Ziel. Die Abteilung reorganisiert Prozesse und Know-how wandert mit den erfahrenen Fachkräften in den Ruhestand. Die junge Mitarbeiterin ist klug, motiviert, ehrgeizig – und sucht Orientierung. Das Onboarding war knapp, das Team wohlwollend, aber ausgelastet. In ihrem ersten Entwicklungsgespräch fragt die Führungskraft: „Trauen Sie sich das zu?“ Sie zögert kurz, dann sagt sie „Ja“. Sie möchte positiv wirken, offen sein, dazugehören. Was sie nicht sagt: Dass ihr das Ziel derzeit kaum erreichbar erscheint. Dass sie Unterstützung braucht, die noch nicht greifbar ist. Ihr „Ja“ ist ein Signal, aber kein echtes Einverständnis. Es ist Ausdruck der Hoffnung, dass das Vertrauen in sie gerechtfertigt ist – und sie nicht überfordert.
Szene 2: Der internationale Deal
Ein deutsches Unternehmen will Lieferketten für technische Komponenten in Indien aufbauen. Die Auftakt-Calls mit potenziellen Partnern verlaufen freundlich, informativ, respektvoll. Ein detaillierter Vertragsentwurf folgt – sachlich, präzise, deutsch. Auf die Frage „Können Sie sich die Zusammenarbeit vorstellen?“ kommt prompt ein „Yes“. Danach: Funkstille. Missverständnis? Nein – mangelhafte Interpretation. In aufgabenorientierten Kontexten markiert das „Ja“ Zustimmung. In beziehungsorientierten Kontexten steht am Anfang Vertrauen, nicht Vertrag. Das „Yes“ bedeutet: „Wir sind im Gespräch – noch nicht im Abschluss.“
Szene 3: Der Antrag auf Solarförderung
Engagierte Eigentümergemeinschaft, Klimaschutz im Blick, kommunale Förderung möglich – die Eckdaten für einen Antrag beim Umweltamt sind gut. Der Berater erläutert Fristen, technische Nachweise, Zuständigkeiten – korrekt, dicht, schnell. Auf „Alles verstanden?“ folgt ein „Ja“. Später fehlen Unterlagen, Fristen verstreichen, der Antrag scheitert. Es war mitnichten alles klar. Doch niemand wollte sein Gesicht verlieren – Rückfragen blieben aus. Das Beratungsgespräch war formal richtig – aber es hat kein Verständnis abgesichert. Daher blieb es wirkungslos.
Diese drei Szenen zeigen: „Ja“ ist ein Container. Es kann Zustimmung, Gesprächsbereitschaft, Höflichkeit, Unsicherheit, Konfliktvermeidung oder leise Ablehnung bedeuten. Führung scheitert oft nicht an mangelnder Klarheit der Worte – sondern an fehlender Anschlussfähigkeit, also an missverständlicher Interpretation des Gehörten.

Warum Vielfalt Prozesse ausbremst – und sie zugleich besser macht
Diverse Teams verbinden unterschiedliche Sprachen, Höflichkeitsregeln, Biografien und Fachlogiken. An den Übergängen – Planung vs. Anpassung, Direktheit vs. Harmonie, Schriftlichkeit vs. Mündlichkeit – entstehen Reibungen. Nicht, weil Menschen „schwierig“ sind, sondern weil ihre Logiken kollidieren.
Ein Beispiel: Ein Projektteam in globaler Besetzung entwickelt ein Produkt. Deutsche Teammitglieder strukturieren Ablauf und Meilensteine, halten am Zeitplan fest. Kolleg:innen aus anderen Regionen agieren flexibler, koordinieren informell, bringen Respekt über Zurückhaltung zum Ausdruck – auch bei Bedenken. Ergebnis: Verzögerungen trotz Motivation. Ursache: Unterschiedliche Kommunikations- und Entscheidungscodes bleiben unübersetzt.
Führen ist wie Dolmetschen. Der Schlüssel liegt in der Übersetzungsarbeit
Gute Führung bedeutet weniger Ansage und mehr Sinnstiftung über Grenzen hinweg. Sie erkennt soziale wie kulturelle Prägungen nicht als Hindernisse, sondern als Kräfte, die Teams bereichern können.
Dafür braucht es ein feines Ohr für Zwischentöne. Worte allein reichen nicht. Ein „Ja“ kann Zustimmung meinen, es kann Höflichkeit sein, oder ein stilles „Bitte um Zeit“. Wer diese Unterschiede wahrnimmt, vermeidet Missverständnisse.
Ebenso wichtig ist die Balance zwischen Beziehung und Aufgabe. In beziehungsorientierten Kontexten hilft es, das Tempo zu drosseln, erst Vertrauen aufzubauen und dann über Verträge zu sprechen. In aufgabenorientierten Kontexten ist es umgekehrt: In der globalen Zusammenarbeit lohnt sich immer, erst Beziehungsanker zu setzen, bevor man die To-do-Liste abarbeitet.
Führung heißt auch, Räume der Sicherheit zu schaffen. Kritik muss möglich sein, ohne dass jemand das Gesicht verliert. Vertrauensvolle Einzelgespräche, anonyme Rückmeldungen oder gezielte Feedback-Techniken können dabei helfen.
Sehr wirkungsvoll sind kurze schriftliche Zusammenfassungen nach Meetings. In wenigen Sätzen lassen sich Zielsetzung, Entscheidung, Zuständigkeit, nächste Schritte und offene Fragen festhalten. Eine klare Bitte um Rückmeldung sorgt dafür, dass alle das Gleiche verstanden haben.
Schließlich zählt auch der Blick auf Herkunft. Soziale Prägungen beeinflussen, wie Menschen in formalen Situationen reagieren. Unsicherheit ist nicht Schwäche, sondern oft nur ein Hinweis auf fehlende Erfahrung. Wer das erkennt, kann Talente stärken, statt sie zu übersehen.
Praxis: Drei Hebel, die sofort wirken
Hebel 1: Gesprächsarchitektur statt Bauchgefühl
In Entwicklungsgesprächen genügt es nicht, nur das Ziel zu benennen. Ebenso wichtig ist die Frage: Wie kommen wir dorthin? Führungskräfte sollten gemeinsam mit Mitarbeitenden klären, welche Voraussetzungen es braucht – vom passenden Wissen über hilfreiche Kontakte bis hin zu Ressourcen. Unterstützungsformate wie Sparring, Shadowing oder ein Buddy-System können dabei Orientierung geben. Frühindikatoren helfen, schon nach wenigen Wochen zu prüfen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und eine Absicherung am Ende ist zentral: „Was könnte dich ausbremsen? Was brauchst du bis wann?“ – solche Fragen öffnen den Raum für konkrete Vereinbarungen.
Hebel 2: Internationale Kooperation – Vertrauen vor Vertrag
Internationale Partnerschaften gelingen besser, wenn Beziehung und Vertrag im Tandem laufen. Sinnvoll ist es, eine Beziehungsphase zu formalisieren: ein Kick-off ohne Vertragsdruck, in dem Arbeitsstile, Eskalationswege, Feiertage und Kommunikationskanäle besprochen werden. Ein Verständnis-Check am Vertragsentwurf – „Welche Punkte wirken für Sie zu früh, zu schnell oder noch klärungsbedürftig?“ – sorgt für Transparenz. Parallel dazu kann man Vertrauen aufbauen und einen ersten Light Letter of Intent mit weichen Formulierungen aufsetzen. Die harten Klauseln kommen später, wenn das Fundament steht.
Hebel 3: Beratung komplexer Verfahren – mit Co-Pilot
Komplexe Antrags- und Beratungsprozesse brauchen Übersicht. Hilfreich ist eine Visualisierung: ein Prozess auf einer Seite, eine Timeline mit allen Fristen. Ebenso wichtig ist die Rollenklärung: Wer sammelt Unterlagen, wer prüft, wer reicht ein? Anstelle der Standardfrage „Alles verstanden?“ wirkt die Teach-back-Methode: „Wie würden Sie den nächsten Schritt jemand anderem erklären?“ So wird deutlich, ob Klarheit besteht. Nach zwei Tagen ein kurzer Check-in – offene Fragen abholen, Stolpersteine beseitigen – und der Prozess bleibt in Fahrt.

Nicht Worte, sondern Kontext entscheiden
Die Geschichten zeigen: Das Wort „Ja“ ist ein Raum für unterschiedlichste Bedeutungen. Mit eindeutiger Klarheit hat das Wort nichts zu tun. Deshalb braucht Führung in vielfältigen Teams eine neue Rolle – die Rolle der Dolmetscherin.
Eine Dolmetscherin übersetzt nicht nur Sprachen, sondern auch Bedeutungen. Sie fragt nach, wenn dasselbe Wort auf beiden Seiten Unterschiedliches meint. Sie schaut auf den Kontext, nicht nur auf den Inhalt. Führung als Dolmetscherin heißt: Begriffe klären, Erwartungen abgleichen, Rollen deutlich machen. In einem internationalen Meeting reicht ein Nicken nicht. Erst wenn die Führungskraft nachfragt, ob das Nicken Zustimmung oder bloß Verständnis ausdrückt, entsteht wirkliche Klarheit.
Doch um diese Rolle ausfüllen zu können, braucht es das dritte Ohr. Dieses Ohr hört das Schweigen, bemerkt die Pause, erkennt die feine Spannung im Raum. Es merkt, wenn ein „Vielleicht“ eigentlich ein Nein ist. Wer dieses Ohr nicht nutzt, geht zufrieden nach Hause und wundert sich später über ausbleibende Ergebnisse. Wer es nutzt, entdeckt Zweifel früh und kann Klarheit schaffen. Das dritte Ohr lässt sich üben – durch kleine Fragen, durch Zusammenfassen, durch den Mut, Unsicherheit anzusprechen.
Vielfalt bedeutet auch, dass Menschen aus verschiedenen sozialen Welten zusammenkommen.
Wer es gewohnt ist, mit Formularen zu arbeiten, findet sich leichter in Bürokratie zurecht. Wer in einer diskussionsfreudigen Familie groß wurde, spricht schneller, fragt nach. Wer gelernt hat, leise zu bleiben, hält sich möglicherweise auch im Beruf zurück. Diese Unterschiede sind kein Mangel, sondern eine Ressource. Sie bringen Widerstandskraft, Beobachtungsgabe, Kreativität und neue Blickwinkel.
Für den Alltag heißt das: Führung muss Räume schaffen, in denen diese Unterschiede nicht untergehen. Statt „Alles verstanden?“ besser fragen: „Was ist noch offen?“ Prozesse sichtbar machen, kleine Rückmeldeschleifen einbauen, Kritik so geben, dass niemand bloßgestellt wird. Und nicht nur das Ziel feiern, sondern auch den Weg dorthin.
Am Ende bedeutet Vielfalt führen, um Brücken zu bauen. Die Dolmetscherin ist das Bild, das bleibt. Sie sorgt dafür, dass nicht nur geredet, sondern auch verstanden wird. So wird aus dem unsicheren „Ja“ ein wirkliches „Ja, ich bin dabei.“
Autorin: Melanie von Groll, Senior Beraterin